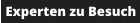Informelle Malerei
Der impulsive Kosmos der Hilla Jablonsky
Hilla Jablonskys Bildwelt lässt der Wahrnehmung des Betrachters weite Spielräume. Ihre Kompositionen stehen
in der Tradition des Informel, das die spontane Geste feierte. Oft entstehen sie auf der Grundlage seelischer
Gefühlszustände. In ihrem unbändigen Beharren auf Subjektivität verwandelt Jablonsky Glücksmomente und
Heiterkeit, Unruhe und Angst, Zorn und Trauer in ein Schlachtfeld aus Farbflecken Linien und grafischen
Kürzeln. Das Erstaunliche: Am Ende steht eine Ordnung von harmonischer Balance.
Feministische Perspektive: Paartanz im Paradies
Der
Wille
zur
Abstraktion
um
jeden
Preis
ist
der
Künstlerin
indessen
fremd.
Die
menschliche
Figur
hat
als
lineare
Chiffre
in
ihrem
imaginierten
Universum
ebenso
Platz
wie
der
Zufall
und
das
Unterbewusste.
Mal
ironisch,
mal
kampfeslustig
stellt
Jablonsky
das
Verhältnis
der
Geschlechter
dar
-
der
Phallus
gehört
dabei
zum
gern
und
häufig
zitierten
Signal.
Da
spreizt
vor
zinnoberrotem
Hintergrund
eine
männliche
Gestalt
ihre
schwarzen
Glieder
wie
ein
Pfau,
eine
entsprechende
Donna
lockt
tänzelnd
mit
ausgebreiteten
Armen.
Die
erotische
Komponente
ist
bei
Jablonsky
immer
mit
einer
Portion
Witz
und
-
rar
aber
offenbar
gibt
es
das
–
augenzwinkerndem
Feminismus
versehen.
„Das
Paradies
ist
anstrengend“
(WVZ
8668)
kommentiert
die
Künstlerin das Balz-Duett zwischen Adam und Eva im Titel.
Die
Fläche
nutzt
sie
als
Aktionsfeld.
Hier
lässt
Hilla
Jablonsky
den
Energien
freien
Lauf.
Auf
dem
Gemälde
„Der
große
Schoß“
(1986,
WVZ
8673)
wirbeln
rote,
blaue,
schwarze
und
weiße
Gebilde
auf
gelbem
Grund.
Umschlossen
sind
sie
von
einem
fleischfarbenen
Rosaton,
eine
weiße
Nabelschnur
durchzieht
die
Bildmitte.
Noch
ist
nichts
ausgebildet
in
diesem
Uterus,
noch
scheint
alles
möglich.
Frau
oder
Mann,
Amöbe
oder
Insekt
–
im
pränatalen
Getümmel
pulsiert
und
gärt
es
mit
explosiver
Vitalität.
Archaische
Gestalten
tauchen
auf,
winzig,
im
Rudel
und
wie
auf
einer
Höhlenzeichnung.
Die Geburt der Schöpfung steht kurz bevor.
Skripturen im Tee: Notate gegen die Flüchtigkeit
Aber
auch
leise,
grazile
Arbeiten
gibt
es.
Unter
ihnen
finden
sich
mit
Tee
eingefärbte
Blätter,
auf
denen
sich
bisweilen
Schriftzüge
entdecken
lassen.
Es
sind
behutsam
gestammelte
Worte,
die
sich
wie
lyrische
Verse
einen
fiktiven
Betrachter
richten:
Notate
gegen
die
Flüchtigkeit
inmitten
eines
Stakkatos
aus
kühlen
Farbspritzern.
Das
Zusammenspiel
ergibt
spannungsgeladene
Improvisationen,
Liebesgeflüster
inklusive.
In
der
Serie
„Kleine
Wonnen“,
bei
der
Jablonsky
die
Bewegung
schwarzer
Zeichen
auf
gelbem
Grund
erprobt,
ist
das
Vokabular
ist
kalligraphisch
verknappt,
alle
Energie
gebündelt
in
wenigen
Strichen
und
Pinselschwüngen.
Die
chaotischen
Kräfte
haben
sich
formiert
zu
einer
lakonischen
Choreographie
von
meditativer
Wirkung:
Die
emotionale
Geste
endet,
für
eine Weile, in gelöster Ruhe.
Märchen und Mythen: Das Meer als Metapher
Woanders
beschwört
Jablonsky
Märchen
und
Mythologien.
So
bewahrt
sie
die
Symbole
unseres
kollektiven
Gedächtnisses
vor
dem
Vergessen.
Zugleich
entfaltet
sich
ein
emanzipatorisches,
oft
auch
feministische
Potenzial.
Die
Rolle
des
Ikarus
beispielsweise
ist
der
Frau
übertragen.
Sie
ist
es,
die
den
Ausbruch
wagt
und
der
nun
Flügel
wachsen.
Mit
Hilfe
ihrer
neu
erlangten
Schwingen
steigt
die
„Ikara“
auf
in
die
Lüfte,
ins
Reich
der
Fantasie.
Die
unten
lauernden
Abgründe
schrecken
sie
nicht
ab.
Der
Traum
vom
Fliegen
ist
natürlich
der
Traum
von
künstlerischer
wie
sinnlicher
Freiheit.
Und
so
schimmern
gerade
in
dieser
Figur
die
Züge
eines
Selbstportraits hindurch.
Auch
bei
den
„Meerfrauen“
die
nicht
zuletzt
Assoziationen
an
das
uralte
Motiv
des
Fischens
wecken,
finden
sich
Hinweise
auf
das
Leben
des
modernen
Menschen.
So
können
die
Netze
–
gesprühte
Gitterstrukturen,
die
auf
Jablonskys
Bildern
immer
wieder
auffallen
–
sowohl
als
Bedrohung,
als
Gefahr
von
Einengung
und
Verstrickung
verstanden
werden,
wie
auch
als
Zeichen
kommunikativer
Verknüpfung.
Ebenso
mehrdeutig
ist
das Gegenstück mit dem Titel „Meermänner“.
Das
Meer
hat
von
jeher
eine
große
Faszination
auf
Hilla
Jablonsky
ausgeübt.
Sie
lebte
viele
Jahre
an
der
Küste,
ihr
Mann
Walter
war
bei
der
Marine.
Biographisches
mag
also
eine
Rolle
spielen.
A
ber
auch
als
romantische
Metapher
des
Stirb
und
Werde
spiegelt
das
Meer
für
Hilla
Jablonsky
eine
Fülle
existentieller
Empfindungen
wider.
Überhaupt
sind
ihre
Arbeiten
von
Naturerscheinungen
und
Landschaftserfahrungen
stärker
inspiriert,
als
man
auf
den
ersten
Blick
festzustellen
glaubt.
So
finden
sich
Wolkenformen,
kleine
Sonnen
und
an
Gestirne
erinnernde
Kürzel.
Gelegentlich
hat
die
Künstlerin
sogar
Sand
auf
die
Leinwand
geschüttet,
um
die
Präsenz
des
Bildes
ins
Taktile
zu
steigern,
um
es
materiell
fühlbar
zu
machen.
Sie
will
eben
alle
Sinne
zum
Sprechen
bringen.
Grenzüberschreitung: Vom Bild zur Aktion
Dafür sprengt Jablonsky hin und wieder den Rahmen des traditionellen Bildes. Schon die farbgetränkten
Tuchreste, aus denen sie ihre kleinen „Nesselstücke“ fertigt, verließen das sichere Terrain, das die zwischen
Holzleisten gespannte Leinwand bietet. Geknittert und zerknüllt, gedreht und gewendet haben sie eine
experimentelle Behandlung durchlaufen, die jede Orientierung von Oben und Unten, Vorne und Hinten bis
zuletzt verweigert. Hier und da werden solche „Nesselstücke“ weiterverarbeitet und – im „Leib-auf-Leib-
Verfahren“ (Jablonsky) – in andere Bilder integriert. Beim „Kleid der Malerin“ gewinnt das eincollagierte
Stoffelement eine zusätzliche Dimension, denn das schürzenähnliche Gewand ist Relikt einer Performance. Es
dokumentiert die Spuren ihrer Aktion „Farben essen“. Dabei setzte Jablonsky ihren Kittel als Malgrund ein, der
nach der „Häutung“, quasi als Beweismittel, überlebt und wiederum zu Kunst mutiert.
Marion Leske (1994/2019)
Experten zu Besuch in Bonn
Marion Leske - Bonn
Kulturjournalistin
Hilla Jablonsky

Stand: 29.12.2019, 17:59
Stand: 29.11.2022, 13:00



Hilla Jablonsky
Experten zu Besuch in Bonn
Marion Leske - Bonn
Kulturjournalistin
Der impulsive Kosmos der Hilla
Jablonsky
Hilla Jablonskys Bildwelt lässt der
Wahrnehmung des Betrachters weite
Spielräume. Ihre Kompositionen stehen
in der Tradition des Informel, das die
spontane Geste feierte. Oft entstehen
sie auf der Grundlage seelischer
Gefühlszustände. In ihrem unbändigen
Beharren auf Subjektivität verwandelt
Jablonsky Glücksmomente und
Heiterkeit, Unruhe und Angst, Zorn und
Trauer in ein Schlachtfeld aus
Farbflecken Linien und grafischen
Kürzeln. Das Erstaunliche: Am Ende
steht eine Ordnung von harmonische
Balance.
Feministische Perspektive: Paartanz
im Paradies
Der Wille zur Abstraktion um jeden
Preis ist der Künstlerin indessen fremd.
Die menschliche Figur hat als lineare
Chiffre in ihrem imaginierten
Universum ebenso Platz wie der Zufall
und das Unterbewusste. Mal ironisch,
mal kampfeslustig stellt Jablonsky das
Verhältnis der Geschlechter dar - der
Phallus gehört dabei zum gern und
häufig zitierten Signal. Da spreizt vor
zinnoberrotem Hintergrund eine
männliche Gestalt ihre schwarzen
Glieder wie ein Pfau, eine entsprechende
Donna lockt tänzelnd mit ausgebreiteten
Armen. Die erotische Komponente ist
bei Jablonsky immer mit einer Portion
Witz und - rar aber offenbar gibt es das –
augenzwinkerndem Feminismus
versehen. „Das Paradies ist anstrengend“
(Wvz 8668)
kommentiert die Künstlerin das Balz-
Duett zwischen Adam und Eva im Titel.
Die Fläche nutzt sie als Aktionsfeld.
Hier lässt Hilla Jablonsky den Energien
freien Lauf. Auf dem Gemälde „Der
große Schoß“ wirbeln rote, blaue,
schwarze und weiße Gebilde auf gelbem
Grund. Umschlossen sind sie von einem
fleischfarbenen Rosaton, eine weiße
Nabelschnur durchzieht die Bildmitte.
Noch ist nichts ausgebildet in diesem
Uterus, noch scheint alles möglich. Frau
oder Mann, Amöbe oder Insekt – im
pränatalen Getümmel pulsiert und gärt
es mit explosiver Vitalität. Archaische
Gestalten tauchen auf, winzig, im Rudel
und wie auf einer Höhlenzeichnung. Die
Geburt der Schöpfung steht kurz bevor.
Skripturen im Tee: Notate gegen die
Flüchtigkeit
Aber auch leise, grazile Arbeiten gibt es.
Unter ihnen finden sich mit Tee
eingefärbte Blätter, auf denen sich
bisweilen Schriftzüge entdecken lassen.
Es sind behutsam gestammelte Worte,
die sich wie lyrische Verse einen fiktiven
Betrachter richten: Notate gegen die
Flüchtigkeit inmitten eines Stakkatos
aus kühlen Farbspritzern. Das
Zusammenspiel ergibt
spannungsgeladene Improvisationen,
Liebesgeflüster inklusive. In der Serie
„Kleine Wonnen“, bei der Jablonsky die
Bewegung schwarzer Zeichen auf
gelbem Grund erprobt, ist das Vokabular
ist kalligraphisch verknappt, alle Energie
gebündelt in wenigen Strichen und
Pinselschwüngen. Die chaotischen
Kräfte haben sich formiert zu einer
lakonischen Choreographie von
meditativer Wirkung: Die emotionale
Geste endet, für eine Weile, in gelöster
Ruhe.
Märchen und Mythen: Das Meer als
Metapher
Woanders beschwört Jablonsky Märchen
und Mythologien. So bewahrt sie die
Symbole unseres kollektiven
Gedächtnisses vor dem Vergessen.
Zugleich entfaltet sich ein
emanzipatorisches, oft auch
feministische Potenzial. Die Rolle des
Ikarus beispielsweise ist der Frau
übertragen. Sie ist es, die den Ausbruch
wagt und der nun Flügel wachsen. Mit
Hilfe ihrer neu erlangten Schwingen
steigt die „Ikara“ (Wvz Nr. Z) auf in die
Lüfte, ins Reich der Fantasie. Die unten
lauernden Abgründe schrecken sie nicht
ab. Der Traum vom Fliegen ist natürlich
der Traum von künstlerischer wie
sinnlicher Freiheit. Und so schimmern
gerade in dieser Figur die Züge eines
Selbstportraits hindurch.
Auch bei den „Meerfrauen“, die nicht
zuletzt Assoziationen an das uralte
Motiv des Fischens wecken, finden sich
Hinweise auf das Leben des modernen
Menschen. So können die Netze –
gesprühte Gitterstrukturen, die auf
Jablonskys Bildern immer wieder
auffallen – sowohl als Bedrohung, als
Gefahr von Einengung und Verstrickung
verstanden werden, wie auch als
Zeichen kommunikativer Verknüpfung.
Ebenso mehrdeutig ist das Gegenstück
mit dem Titel „Meermänner“.
Das Meer hat von jeher eine große
Faszination auf Hilla Jablonsky
ausgeübt. Sie lebte viele Jahre an der
Küste, ihr Mann Walter war bei der
Marine. Biographisches mag also eine
Rolle spielen. Aber auch als romantische
Metapher des Stirb und Werde spiegelt
das Meer für Hilla Jablonsky eine Fülle
existentieller Empfindungen wider.
Überhaupt sind ihre Arbeiten von
Naturerscheinungen und
Landschaftserfahrungen stärker
inspiriert, als man auf den ersten Blick
festzustellen glaubt. So finden sich
Wolkenformen, kleine Sonnen und an
Gestirne erinnernde Kürzel.
Gelegentlich hat die Künstlerin sogar
Sand auf die Leinwand geschüttet, um
die Präsenz des Bildes ins Taktile zu
steigern, um es materiell fühlbar zu
machen. Sie will eben alle Sinne zum
Sprechen bringen.
Grenzüberschreitung: Vom Bild zur
Aktion
Dafür sprengt Jablonsky hin und wieder
den Rahmen des traditionellen Bildes.
Schon die farbgetränkten Tuchreste, aus
denen sie ihre kleinen „Nesselstücke“
fertigt, verließen das sichere Terrain, das
die zwischen Holzleisten gespannte
Leinwand bietet. Geknittert und
zerknüllt, gedreht und gewendet haben
sie eine experimentelle Behandlung
durchlaufen, die jede Orientierung von
Oben und Unten, Vorne und Hinten bis
zuletzt verweigert. Hier und da werden
solche „Nesselstücke“ weiterverarbeitet
und – im „Leib-auf-Leib-Verfahren“
(Jablonsky) – in andere Bilder integriert.
Beim „Kleid der Malerin“ gewinnt das
eincollagierte Stoffelement eine
zusätzliche Dimension, denn das
schürzenähnliche Gewand ist Relikt
einer Performance. Es dokumentiert die
Spuren ihrer Aktion „Farben essen“.
Dabei setzte Jablonsky ihren Kittel als
Malgrund ein, der nach der „Häutung“,
quasi als Beweismittel, überlebt und
wiederum zu Kunst mutiert.
Marion Leske (1994/2019)
Stand: 29.11.2022, 13:00
Stand: 29.12.2019, 17:43


Hilla Jablonsky